Mit dem European Green Deal zur Flächenkreislaufwirtschaft
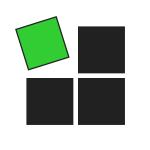
Flächenbestand nutzen, Neuversiegelung vermeiden, Böden schützen und Natur wiederherstellen. Dieser Text zeigt, wie der European Green Deal und seine begleitenden Verordnungen, Richtlinien und Aktionspläne die Flächenkreislaufwirtschaft direkt und indirekt stärken mit klaren Zielen, Vorgaben und Indikatoren.
Dieser Text basiert auf einem Vortrag von Prof. Dr. Petra Schneider im Rahmen einer Weiterbildungsveranstaltung der Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-Anhalt (LAF) und der Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) am 9. September 2025 an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
EU-Ziel: Bestand nutzen, Flächenverbrauch vermeiden
Der Europäische Green Deal ist die 2019 verabschiedete neue Wachstumsstrategie der EU. Gemeint ist hierbei ein Wachstum, das sich vom Einsatz endlicher Ressourcen entkoppelt und unsere Wirtschaft sauberer, widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger macht. Für die Fläche heißt das: Flächeninanspruchnahme begrenzen, Böden „gesund halten“ und Natur wiederherstellen – sprich: den Bestand nutzen, statt immer neue Grünflächen zu versiegeln.
Ein zentrales Element des European Green Deal ist die EU-Bodenstrategie 2030. Sie verankert das Leitbild „gesunde Böden bis 2050“ und das Ziel der Netto-Null bei der Flächenneuinanspruchnahme, also keine zusätzliche Nutzung bislang unbebauter Flächen. Entscheidend ist die Prioritätenfolge bei der Flächeninanspruchnahme: zuerst Flächenrecycling – das heißt, bereits genutzte Standorte wiederverwenden, z. B. kontaminierte Industriestandorte, brachliegende Infrastruktur oder leerstehende Einkaufszentren und Handelsflächen, und erst danach, wenn es wirklich nicht anders geht, Außenentwicklung - Neubau auf der „grünen Wiese“ am Siedlungsrand. Damit wird bodenschonende Raumordnung zum ausdrücklichen EU-Ziel – Rückenwind für den Schutz besonders hochwertiger Böden.
Messen und umsetzen: Kennzahlen für wirksames Flächenmanagement
Damit es nicht bei Absichtserklärungen bleibt, sieht der Entwurf der EU-Bodenüberwachungsgesetz europaweit einheitliche Indikatoren vor. Für das Flächenmanagement sind dabei maßgeblich: Flächeninanspruchnahme, Rücknahme der Inanspruchnahme (das ist die zurückgewonnene Fläche), Netto-Landnahme und der Versiegelungsgrad. Optional können Staaten zusätzlich die Wiedernutzungsrate (neue Nutzung bereits genutzter/bebauter Areale) erfassen. Indikatoren der Bodengesundheit – etwa Erosion, Bodenbelastung oder Verdichtung – zeigen, wo Schutz oder Sanierung nötig ist. Der Null-Schadstoff-Aktionsplan setzt komplementierend Leitplanken gegen Verschmutzung von Boden, Wasser und Luft. Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur verpflichtet, bis 2030 in Städten keine Netto-Verluste an Grün- und Baumkronenflächen zuzulassen und danach Zuwächse zu erreichen – ein direkter Hebel für Entsiegelung und Entwicklung im Bestand. Zudem verlangt sie Wiederherstellungsmaßnahmen in Flüssen, Mooren und Wäldern sowie nationale Wiederherstellungspläne. Diese Vorgaben steuern die Raumplanung und schützen sensible Landschaftsräume und tragen so dazu bei, zusätzliche Neuinanspruchnahme von Flächen zu vermeiden.
Deutschland stellt auf Kreislauf um
In Deutschland spiegelt die seit vielen Jahren bestehende Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie diesen Kurs. Die Fortschreibung von 2025 bekräftigt: Der tägliche Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche soll bis 2030 auf unter 30 Hektar sinken und bis 2050 wird ein Flächenverbrauch von netto null angestrebt. Der aktuelle Vierjahresmittelwert 2020-2023 liegt bei 51 Hektar täglich – der Handlungsbedarf ist also groß. Neu beziehungsweise geschärft sind drei Punkte: Erstens rückt die Mehrfachnutzung vorhandener Flächen noch stärker in den Mittelpunkt, bevor neue Baugebiete ausgewiesen werden. Zweitens ergänzt ein Indikator den Blick auf den Grad der Bodenversiegelung; die Siedlungsdichte soll nicht sinken. Drittens werden zentrale Themenfelder mit Verantwortlichkeiten, Zeitpfaden und Indikatoren hinterlegt – aus Leitbildern werden konkrete Aufträge.
Drei Schlüsselbegriffe:
- Flächenkreislaufwirtschaft ... bezeichnet die vorrangige Wiedernutzung bereits in Anspruch genommener Flächen, gezieltes Entsiegeln und Vermeidung neuer Inanspruchnahme – mit dem langfristigen Ziel eines Netto-Null-Zuwachses.
- Revitalisierung ... bedeutet vormals genutzte Standorte wieder zu nutzen - häufig nach Altlastensanierung - für Wohnen, Arbeiten oder gestaltete Grün- und Freiräume.
- Renaturierung ... umfasst die ökologische Wiederherstellung hin zu naturnahen Zuständen und Prozessen. Wenn Revitalisierung „Grün“ schafft, entsteht in der Regel geplanter städtischer Freiraum; Renaturierung überlässt Flächen möglichst wieder natürlichen Dynamiken, etwa durch Wiedervernässung von Mooren oder naturnahe Flussauen. Beide Ansätze greifen ineinander.
Auf Grundlage der der EU-Bodenstrategie, der (kommenden) EU-Bodenüberwachungsrichtlinie, des Null-Schadstoff-Aktionsplans, der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur sowie der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie
- setzt der Bund Ziele und Kennzahlen, richtet Förderprogramme aus und klärt Berichtspflichten,
- passen die Länder Landes- und Regionalpläne an, legen – wo rechtlich vorgesehen – Bodenschutzgebiete und Bodenbelastungsgebiete fest und fördern Flächenrecycling,
- erfassen Kommunen systematisch ihre Potenzialflächen, definieren jährliche Wiedernutzungs- und Entsiegelungsziele und prüfen neue Vorhaben konsequent nach dem Grundsatz „Bestand zuerst“.
So wird die Flächenkreislaufwirtschaft Schritt für Schritt vom Leitbild zur gelebten Praxis – im Sinne des European Green Deal.
Materialien und Links:
- Vortrag Prof. Dr. Petra Schneider vom 9.9.2025 "Der Europäische Green Deal – Relevanz für
Altlastensanierung und Flächenrevitalisierung"
- BMUKN: Flächenverbrauch – Worum geht es? - Informationsseite des Ministeriums
- Aktion Fläche - Portal für kommunales Flächensparen
- Bodenschutz - Überblicksseite des Ministeriums inklusiver Informationen zur aktuellen Politik
- Nachhaltigkeitsindikator über die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke
- Hoymann, J., & Goetzke, R. (2018). Flächenmanagement. In ARL – Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hrsg.), Handwörterbuch der Stadt- und Raumentwicklung (S. 675–686). Verlag der ARL.
- Fina, S., Hamacher, H., Rönsch, J., & Scholz, B. (2023). Flächenmonitoring und Flächenverbrauch im internationalen Vergleich – Methoden und Daten; Abschlussbericht (Texte 125/2023). Umweltbundesamt.
- EU-Strukturförderung für Klima- und Umweltschutz (zum European Green Deal) - Informationsseite des Ministeriums
- Die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Hintergrundinformationen) - Informationsseite des Ministeriums




| Voriger Beitrag | Zurück zur Übersicht | Nächster Beitrag |

